Ansichten
zu Politik und Recht
Eugen David
1999 - 2011 Ständerat, Mitte [CVP]
1987 - 1999 Nationalrat, Mitte [CVP]
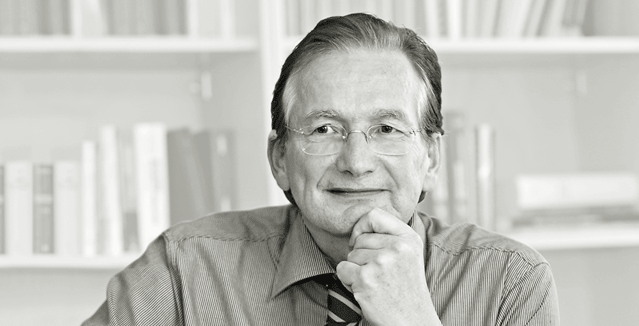
Ansichten
zu Politik und Recht
Eugen David
1999 - 2011 Ständerat, Mitte [CVP]
1987 - 1999 Nationalrat, Mitte [CVP]
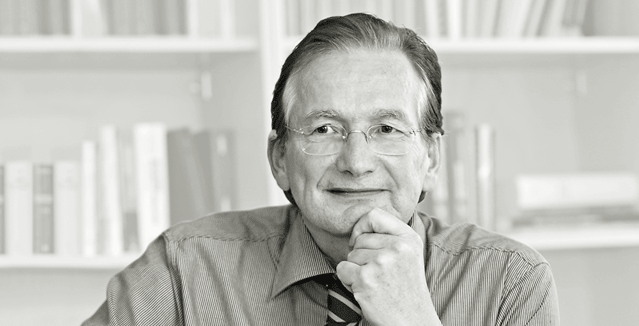
Das Ringen von FDP-BR Cassis um Anerkennung seiner politischen Aktivitäten durch den russischen Despoten Putin war vor, während und nach der Bürgenstock-Konferenz vom 15./16. Juni 2024 bemerkenswert ....................
Im Mai 2024 veröffentlicht eine „Arbeitsgruppe fairer Bilateralismus“ ein Papier zur aktuellen schweizer Europapolitik.
Die Publikation trägt den Titel ....................
Unter dem Hitler-Regime (1933- 1945) organisierte die allein herrschende NSDAP die Überwachung der Bevölkerung und die Verfolgung von Opponenten mit einem Netzwerk von Blockwarten. ....................
Am 13. Februar 2024 hat sich die Aussenpolitische Kommission des Ständerats (APK-S) zum bundesrätlichen Mandatsentwurf für Verhandlungen mit der EU geäussert. ....................
Seit 2011 publiziert das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Papiere über die aussenpolitische Strategie der Schweiz. ....................
Der russische Aussenminister Lawrow war am 23.01.24 kurzfristig nach New York gereist, um sich im UN-Sicherheitsrat über die ukrainische Selbstverteidigung gegen den russischen Überfall zu beschweren. ....................
Am 14. Januar 2024 war der chinesische Premierminister Li Qiang auf Schweiz-Besuch. ....................
Am 8. November 2023 teilt der Bundesrat Frau von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, in einem Brief mit, er werde „entsprechend den im Common Understanding festgehaltenen Landezonen ein Verhandlungsmandat vorbereiten“. ....................
Ab 1. Januar 2024 beteiligt sich das Brexit-Land Grossbritannien an den EU-Programmen Horizon Europe und Copernicus. ....................
Der Bundesrat wiederholt in seinen Verlautbarungen: «Wir sind Teil der europäischen Wertegemeinschaft».
Das EDA reicht den Satz gerne an die Medien weiter. ....................
Am 18. Juli 2023 reiste FDP-BR Cassis nach Brüssel und besuchte dort erneut EU-Kommissar Sefcovic. ....................
Neben der laufenden Übernahme des europäischen Rechts im Rahmen der Bilateralen Verträge gehört der autonome Nachvollzug des europäischen Rechts zur europapolitischen Strategie des Bundesrates. ....................
Wer weiss heute, was die vom Bundesrat deklarierte Neutralität der Schweiz bedeutet? ....................
Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) positionierte sich letztmals am 25. Juni 2010 grundsätzlich zu Europa mit folgenden Punkten: ....................
Am 28. Februar 2023 publizierte das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP), gemeinsam mit dem deutschen Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW) und dem österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung Wien (WIFO), eine Studie unter dem Titel „Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und der EU. ....................
Unter dem Label „Schutzmacht“ vertritt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA die Interessen des totalitären iranischen Mullah-Regimes in Ägypten, Saudi-Arabien, Kanada und in den USA. ....................
Am 9. Dezember 2022 publizierte der Bundesrat einen Bericht unter dem Titel „Lagebeurteilung Beziehungen Schweiz-EU“. ....................
Prof. Dr. Matthias Oesch und David Campi, MLaw, Universität Zürich, haben im Oktober 2022 ein Buch mit dem Titel „Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union“, veröffentlicht.. ....................
Die Aussenpolitik des Bundesrates fokussiert seit Jahren zunehmend auf autoritäre Regimes, sei es in Russland, in China, in der Türkei, in Kasachstan oder im Iran. ....................
Die Schweiz und Malta sind am 9. Juni 2022 von der UN-Generalversammlung in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Die beiden Länder nehme für die Jahre 2023/24 die zwei nicht-ständigen Sitze der Western European and Other States UN-Group (WEOG) ein. ....................
Die einheimischen Rechtsnationalen sind eine veritable politische Macht, mit 55 SVP-Nationalräten, 7 SVP-Ständeräten, 2 SVP-Bundesräten. ....................
Schweden und Finnland, die bisher eine Neutralitätspolitik verfolgten, sind der NATO beigetreten. Grund ist der Überfall Putins auf die Ukraine am 24. Februar 2022. . ....................
Prof. Michael Ambühl und Dr. Daniela Scherer, beide ETHZ, veröffentlichen einen Vorschlag für ein Bilaterale-III-Paket (Michael Ambühl / Daniela S. Scherer, Bilaterale III, EIZ-Publishing, 2022). ....................
Seit Putin die Herrschaft im Kreml übernommen hat, organisieren Im Kanton Zug russische Oligarchen aus seinem Umfeld zu 80% den internationalen Verkauf der russischen Rohstoffe. ....................
Der Bundesrat hat enge Verbindungen zum kommunistischen Einparteien-Regime in China. ....................
Am 25.02.22 präsentiert der Bundesrat der Öffentlichkeit seine „Stossrichtung“ für ein „Verhandlungspaket“ mit der EU. ....................
Am 24.02.22 hat der russische Diktator Putin, ein ex-KGB-Agent der Sowjetunion, mit 150‘000 Soldaten, Panzern, Kampfflugzeugen, Kanonen und Raketen die Ukraine überfallen. ....................
Russland hat in den letzten Monaten über 100‘000 Soldaten mit schwerem Gerät, Panzer, Raketen und Kanonen, an die Grenze zur Ukraine entsandt. ...............
Unter Führung von SVP-Bundesrat Parmelin haben am 24. November 2021 das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ihre Strategie zur Aussenwirtschaftspolitik publiziert. ...............
Nach Abbruch der Verhandlungen am 26. Mai 2021 durch die SVP/FDP-Koalition im Bundesrat erklärt Anfang Juli 2021 EDA-Staatssekretärin Leu vor den Medien, die Schweiz habe der EU zahlreiche Konzessionen gemacht. Das müsse genügen. ...............
er Bundesrat setzt in seiner Aussenpolitik in Europa primär auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE mit ihren 57 Teilnehmerstaaten. ...............
Vor einem Jahr, am 23. September 2020, hat die EU-Kommission ein europäisches Gesetzgebungsverfahren betreffend die EU-Aussengrenzen eingeleitet. ...............
Laut FDP-BR Cassis hat der Bundesrat im Zeitpunkt des Abbruchs der Verhandlungen mit der EU, am 26. Mai 2021, einen 3-Phasenplan beschlossen.. ...............
Die EU-Kommission hat im Juli 2021 gegen Ungarn ein Verfahren wegen Verletzung der europäischen Rechtsstaats-Prinzipien eingeleitet. ...............
Im April 2019, im Vorfeld der Brexit-Verhandlungen, hatten sich EU-Rat, EU-Parlament und EU-Kommission auf Grundsätze für die Verhandlungen verständigt. ...............
Seit die SVP/FDP-Koalition die Regierungsmehrheit übernommen hat (2003), ist ein Ausbau des Polizei- und Überwachungsstaats im Gang. ...............
«Der Bundesrat muss endlich seine Geheimniskrämerei beenden und dem Land erklären, was er vorhat» meint FDP-Präsidentin Gössi in der NZZ vom 22.04.21. ...............
"Der sogenannte bilaterale Weg auf der Basis sektorieller Abkommen ist der für die Schweiz massgeschneiderte Ansatz zur Gestaltung ihrer Beziehungen zur EU“. ...............
Der Bundesrat hat seit 19. März 2021 eine Strategie für das Verhältnis der Schweiz zum totalitären China. ...............
In einem Interview meint der ehemalige Nationalbankpräsident Hildebrand, die Schweiz habe in den letzten Jahren auf dem internationalen Parkett an Bedeutung eingebüsst. ...............
Aus dem Verlauf der Brexit-Verhandlungen kann die Schweiz Rückschlüsse zu den Erfolgsaussichten ihrer Position in den Verhandlungen mit der EU über das Rahmenabkommen ziehen.
...............Bis 2003 war der Beitritt der Schweiz zur EU eine Option des Bundesrates.
Mit dem Eintritt von SVP-BR Blocher, SP-BR Calmy-Rey und FdP-BR Merz änderte sich die Lage.
...............
Roman Hertler, redaktion@saiten.ch (RH):
Eugen David (ED), politisch sind sie in den vergangenen Jahren nicht mehr gross in Erscheinung getreten.
Warum jetzt das Engagement für die Konzern-Initiative?
...............
Konzerne, mit Sitz in der Schweiz, zB Nestlé, sollen gesetzlich festgelegte Sorgfaltspflichten bezüglich Menschenrechte und Umweltschutz einhalten, wenn sie in fernen Ländern ihre Geschäfte machen.
...............
Der Walliser Yves Donzallaz, SVP-Mitglied, liess sich 2008 von der SVP als Bundesrichter vorschlagen.
Schon damals war die Praxis der Rechtsnationalen bekannt, bei ihren Anhängern in der Bundesversammlung vor Erneuerungswahlen Streichlisten zirkulieren zu lassen. ...............
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begründete ihre Zustimmung zu gemeinsamen EU-Anleihen und zu innereuropäischen Finanzausgleichsleistungen aufgrund der Corona-Krise wie folgt:
“Europa muss gemeinsam handeln, der Nationalstaat allein hat keine Zukunft.
...............
Die US Marine verfügt über 14 atomwaffentragende U-Boote im aktiven Dienst.
Jedes dieser U-Boote hat atomare Sprengköpfe an Bord, welche die Sprengkraft aller im 2. Weltkrieg abgeworfenen Bomben um das 10-fache übertreffen.
Zwei Drittel der US-Atomsprengköpfe befinden sich auf U-Booten der US-Navy.
Abgeschossen werden sie mit Trident-Langstrecken-Raketen.
...............
Politik, Massenmedien und Bevölkerung wünschen sich schnelle und einfache «Wahrheiten», auch dann, wenn die Fakten schlecht zu erkennen, komplex und schwierig zu verstehen sind.
Besonders gross ist dieses Bedürfnis in Krisenzeiten.
Die Corona-Krise hat die These erneut bestätigt.
Ein Interview des Bürgerlichen Komitees (BK) mit Eugen David (ED).
BK:
Wieso haben Sie sich entschieden, sich dem Bürgerlichen Komitee für Konzernverantwortung anzuschliessen?
ED:
In der Schweiz befinden sich einige Zentralen weltweit tätiger Konzerne. ...............
Der Bundesrat hat am 29. Januar 2020 seine aussenpolitische Strategie für die Jahre 2020 – 2023 beschlossen.
Liest man die 40 Seiten, bleibt ein bestimmender Eindruck: weiter so wie bisher. Alles bleibt beim Alten, auch wenn rund um die Schweiz vieles in Bewegung ist.
...............
Putin und Erdogan haben die Achillesferse der Europäer entdeckt:
die Migration, und beuten sie gnadenlos für ihre Interessen aus. ............
Die deutsche AfD und die schweizerische SVP haben dieselbe Weltanschauung: völkischer Nationalismus.
Sie haben dieselben Feinde: Ausländer und die Europäische Union.
Und sie haben dieselben fanatischen Anhänger in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten und auf der Strasse: Wutbürger.
.........
Am 29. März 2017 hat die britische Premierministerin Theresa May der EU mitgeteilt, Grossbritannien wolle aus der Europäischen Union austreten.
Sie selbst hatte im Referendum den Austritt abgelehnt, wandelte sich aber zur Speerspitze des Brexit und erklärte die Fernhaltung weiterer Europäer von den britischen Inseln zum Dogma.
.........
Seit den Bundesratswahlen 2017/18 sind Staaten, die von autoritären Führern beherrscht werden,
ein bevorzugtes Reiseziel der Schweizer Regierung.
Besonders aktiv sind die Regierungsmitglieder U. Maurer und I.Cassis. .........
Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg (17.10.19) hat ein früherer Banker der Credit Suisse vor einem New Yorker Gericht gestanden, er habe für die Vermittlung eines CS-Darlehens von 2 Milliarden Dollar an Firmen in Mozambique 45 Millionen Dollar Bestechungsgelder entgegengenommen. .........
Das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat am 2. Juli 2019 der Öffentlichkeit den Bericht AVIS28 vorgestellt. AVIS28 ist eine EDA-Abkürzung für „Aussenpolitische Vision Schweiz 2028“
BR Cassis stellt in der Einleitung klar:
„Bei der Europapolitik hat der Bundesrat seine Vision bereits dargelegt:
Die Schweiz braucht den bestmöglichen Marktzugang zur EU bei grösstmöglicher Eigenständigkeit. Der konsolidierte bilaterale Weg bleibt das geeignete Modell hierzu.“ ...........
Am 2. Mai 2019 hat der Aussenminister der Öffentlichkeit mit dem Bericht zur Internationalen Zusammenarbeit der Schweiz 2021 – 2024 seine Ziele für die künftige Ausrichtung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bekannt gegeben.
Der Bericht lässt den Wunsch erkennen, die DEZA an die konfliktbeladene schweizerische Innenpolitik anzubinden. ........
2018 erläuterte ein hoher Bundesbeamter in einem Vortrag die Empörungskurve in der schweizerischen Europapolitik.
Er beobachte diese Kurve seit vielen Jahren.
Die Regierungskunst besteht darin, im Verlauf der Empörungskurve den richtigen Zeitpunkt für die Volksabstimmung zu treffen. .........
In den letzten 20 Jahre fand die Schweiz kaum jemals ein positives Interesse bei amerikanischen Administrationen, unabhängig davon, wer US-Präsident war.
2019 hat sich das Blatt gewendet.
Der Schweizer Aussenminister und der Schweizer Bundespräsident reisen auf Aufforderung der Trump - Administration nach Washington. ...........
Die NZZ hat am 16. Mai 2019 den rechtsnationalen ehemaligen Goldman-Sachs-Mann und Trump-Gehilfen Bannon vor den Wahlen zum Europäischen Parlament in Berlin zu einem grossen Interview eingeladen.
Das Interview trägt die Schlagzeile von Bannon: „Jeder Tag in Brüssel wird Stalingrad sein“. ........
SVP-Bundesrat Maurer war beim Generalsekretär der Kommunistischen Partei in China und lauschte den Worten des Grossen Vorsitzenden.
China hat einige Errungenschaften, welche die Schweiz und Europa noch nicht haben oder einmal hatten, darauf aber nach zwei Weltkriegen verzichtet haben. .........
Die Schweiz fördert die effektive Verwirklichung der Menschenrechte jedes Einzelnen.
So steht es in der Menschenrechtsstrategie 2016-2019 des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA).
Grundlage der Strategie – so heisst es weiter - ist die Entwicklung unseres Landes hin zu einer engagierten und konsequenten Menschenrechtspolitik. .........
Der Bundesrat hat am 25. Februar 2019 ein Abkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland (UK) unterzeichnet
[Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confederation on Citizens’ Rights following the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and the Free Movement of Persons Agreement]. .............
In offiziellen Verlautbarungen zu den Beziehungen zur EU ist nicht mehr vom Königsweg, sondern vom Sonderweg der Schweiz die Rede.
Als neutraler „Sonderfall“ verstand sich die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Kriegs bis zum Mauerfall.
Das lernte damals jeder Rekrut in der obligatorischen Rekrutenschule.
Der Schweizer „Sonderweg“ in Europa reiht sich psychologisch in die Historie des „Sonderfalls“ ein. ..........
Am 7. Februar 2019 war BR Cassis in den USA und traf sich mit Trumps Aussenminister Pompeo.
Ein analoges Treffen hat seit mehr als zehn Jahren nicht mehr stattgefunden.
Die Trump-Administration gilt im EDA, ungeachtet der „America first“-Parolen, gegenwärtig als bevorzugter Verhandlungspartner der Schweiz. ........
Die Wirtschaftskommission des Nationalrates hat im Februar 2019 bei zwei Universitätsprofessoren Rechtsgutachten zum Institutionellen Abkommen (= Rahmenabkommen) eingeholt. ........
Der periodische Bericht des Rates der Regierungen der EU-Länder über die Beziehungenzwischen der Europäischen Union und der Schweiz ist eine Fundgrube.
Regelmässig erfährt man Dinge über die in der Schweiz weder Bundesstellen, noch Medien informieren. ........
Die Wirtschaftskommission (WAK) des Nationalrates fragt sich (30.01.2019), wie gross das Ermessen des Schiedsgerichts sei, „wenn dieses von der EU angefragt wird, den Europäischen Gerichtshof anzurufen.“
Dazu sollen Rechtsgutachten eingeholt werden. ........
Die Brexiteers der britischen Tory-Partei behaupten, das Vereinigte Königreich (UK) werde mit dem Brexit stärker.
Denn: UK kann selbst bestimmen, mit wem es Handel treiben will und es kann selbst die Konditionen festlegen. ........
Chefredaktor Rutishauser von Tamedia schreibt am 26. Januar 2019 im Tagesanzeiger: „Das Rahmenabkommen mit der EU ist in der jetzigen Form unannehmbar und muss entweder nachgebessert oder abgelehnt werden.“
„ Das Abkommen ist einer Demokratie unwürdig. ........“
Das Institutionelle Abkommen (= Rahmenabkommen) sei Gift für die Sozialpartnerschaft lässt der Gewerkschaftsbund durch seinen Sekretär und Chefökonom im Dezember 2018 in der NZZ mitteilen.
Vom andern Ende des politischen Spektrums kommt in derselben Zeitung im Januar 2019 das Echo vom Direktor des Gewerbeverbandes: “Wir wollen die Sozialpartnerschaft nicht auf Druck der EU preisgeben." ........
Am 25. März 1957, zwölf Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs, gründeten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande in Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.
Die Römer-Verträge traten am 1. Januar 1958 in Kraft.
Ziel war es, Schritt um Schritt einen gemeinsamen Markt mit den vier Grundfreiheiten zu schaffen. ........
Die Schweiz hat am 21. Juni 1999 mit der Europäischen Union (EU) fünf Abkommen über die sektorielle Beteiligung der Schweiz am europäischen Binnenmarkt abgeschlossen (sog. Bilaterale Verträge I).
Die Abkommen über:
Die beiden freisinnigen Bundesräte, die das Parlament am 20. September 2017 und am 5. Dezember 2018 gewählt hat, folgen den Vorstellungen der Rechtsnationalen, lehnen die Europäische Union als nützliche politische Organisation für Europa ab und rechnen über kurz oder lang mit dem Untergang der EU.
Ihre Vorgänger aus derselben Partei beurteilten die Europäische Union positiv:
als Voraussetzung für Friede, Freiheit und Wohlstand der Völker auf dem europäischen Kontinent und dies unabhängig vom Verhältnis der Schweiz zur EU. ........
Die Zukunft von Premierministerin May und des von ihr mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommens ist ungewiss.
Die entscheidenden Abstimmungen im Britischen Unterhaus stehen aus.
In der Tory Unterhausfraktion gibt es zahlreiche, unter sich zerstrittene Gruppen, die das von May ausgehandelte Abkommen ablehnen und andere Vorschläge machen.
Einiges Gewicht hat Amber Rudd, die Ministerin für Arbeit und Vorsorge.
Sie ist eine mögliche Nachfolgerin von Theresa May, wenn diese im Unterhaus mit ihren Plänen scheitert.
Rudd befürwortet das „Norwegen-Plus-Modell“.
Damit ist ein EWR-Lösung gemeint und – zusätzlich als „Plus“ – ein Zollabkommen mit der EU (à la Türkei). ........
Der Staats-Schuldenberg der USA hat 16‘000 Milliarden Dollar erreicht (16‘000‘000‘000‘000 $). Wofür geben die Amerikaner das geliehene Geld aus? Primär für ihr Militär: rund 700 Milliarden Dollar pro Jahr.
Davon geht rund die Hälfte an die grossen privaten US-Waffenkonzerne wie Lockheed Martin, Halliburton, Northrop Grumman, Booz Allen Hamilton, CACI, General Atomics, General Dynamics, BAE, Leidos etc.
80% der pensionierten US-Generäle arbeiten nach ihrem Militär-Job für die US-Waffenindustrie. .........
USA, Mexico und Kanada haben das North American Free Trade Agreement (NAFTA) revidiert.
Voraussichtlich wird das neue Abkommen, unter dem Kürzel USMCA, ab 2020 angewendet.
Das geänderte Abkommen enthält zum grossen Teil dieselben Regeln wie NAFTA.
In einigen Positionen übernimmt es Bestimmungen aus dem Trans-Pacific-Partnership Abkommen (TPP), an welchem sich die Trump-Administration seit Januar 2017 nicht mehr beteiligt. ........
US-Konzerne haben viele Hunderte Milliarden US$ in liquiden Anlagen in den Banken europäischer Steueroasen geparkt, vor allem in den Niederlanden, der Schweiz, Irland und Luxemburg.
Kürzlich haben die Amerikaner ihr Gesetz geändert: Gelder, welche die Konzerne aus den europäischen Steueroasen in die USA zurückführen, werden einmal mit 15 % besteuert.
Vorher lag der Satz bei 35%.
Jetzt ziehen die US-Konzerne ihre in europäischen Steueroasen geparkten Milliarden ab.
Im ersten Quartal 2018 sind 300 Milliarden US$ abgeflossen. ........
Für das Verhältnis zu Drittstaaten, die sich am europäischen Binnenmarkt beteiligen möchten, hat die EU verschiedene Instrumente entwickelt: gegenseitige Anerkennung (mutual recognition), Äquivalenz (equivalence), Passport (passporting).
Die aktuellen Kontroversen der Schweiz mit der EU über den Zugang der Schweizer Börse, der Schweizer Banken oder der Schweizer Produzenten von Medizinalprodukten zum europäischen Binnenmarkt haben mit diesen Instrumente zu tun.
Anhängig sind gegen zwanzig Bereiche von Produkten oder Dienstleistungen, für welche die Schweiz eine Äquivalenzerklärung der EU-Kommission oder eine „gegenseitige“ Anerkennung (u.a. Stromhandel) erhalten möchte. ........
In vielen politischen Debatten – gerade in westlichen Ländern – werden Demokratie und Freiheit gleichgesetzt.
Das ist ein Fehler.
Seit der Antike ist bekannt: die alleinige absolute Macht der Mehrheit garantiert weder die Freiheit des Einzelnen, noch die Freiheit von Minderheiten.
Freiheit gibt es nur, wenn der Staatsmacht institutionell abgesicherte Grenzen gesetzt sind.
Das gilt genauso für Demokratien, Oligarchien und Monarchien. ........
Die EU-Entsenderichtlinie vom 16.12.1996 (Richtlinie 96/71/EG) sieht vor, dass die nationalen Regeln des Arbeitsrechts, einschliesslich der Lohnregeln, am Arbeitsort auch für Arbeitnehmer gelten, die grenz-überschreitend tätig sind (sog. entsandte Arbeitnehmer).
D.h. auf die Schweiz bezogen: das Schweizer Arbeitsrecht ist auf das Arbeitsverhältnis entsandter Arbeiter anwendbar, auch bezüglich der Löhne.
Mit der EU-Richtlinie 2014/17 vom 28.05.2014 haben das Europäische Parlament und der Rat zusätzliche Regeln für grenzüberschreitende Arbeiten festgelegt.
Danach müssen Betriebe, die grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen möchten, den Behörden am Arbeitsort spätestens bei Beginn der Arbeiten eine Meldung machen. ........
Eine Einigung mit der EU ist nur möglich, wenn die EU die Unabhängigkeit unserer Institutionen anerkennt.
Das erklärte kürzlich Staatssekretär Balzaretti, Chefkoordinator der schweizerischen Europapolitik.
Ideologisch bedient die Aussage den aktuellen Mainstream der schweizerischen Europapolitik in Bundesrat und Parlament.
Macht diese Art Kommunikation Sinn?
Stärkt sie die Position der Schweiz in den Verhandlungen mit der EU?
Mit den schweizerischen Institutionen meint Staatssekretär Balzaretti auch den eidgenössischen Gesetzgeber, d.h. Parlament und Volk. ........
Zwischen der EU und der Ukraine existiert seit 27. Juni 2014 ein Assoziierungsabkommen.
Hauptinhalt ist eine Freihandelszone auf der Basis des europäischen Binnenmarktrechts.
Die Freihandelszone ist seit 1.9.2017 in Kraft. ........
Die Schweizer Nationalbank flutet seit Jahren die internationalen Devisenmärkte mit frisch gedruckten Schweizerfranken.
Im Jahr 2017 hat sich der Bestand der mit neu gedrucktem Geld gekauften ausländischen Devisen um 94 Milliarden CHF auf 790 Milliarden CHF erhöht.
Der Schweizer Franken soll eben im globalen Devisenhandel eine wichtige Rolle spielen.
Das hat Priorität. ........
Warum besteht die Europäische Union auf institutionellen Regeln im bilateralen Verhältnis zur Schweiz?
Warum lehnt es die EU ab, ohne solche Regeln der Schweiz einen erweiterten Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu gestatten, beispielsweise im Finanzmarkt oder im Energiemarkt?
Am 17. Dezember 2004 hat das CH-Parlament ein Gesetz zu den Bilateralen II beschlossen, das seit 1. April 2006 in Kraft ist.
Das Gesetz macht Vorschriften für ausländische Betriebe, die in der Schweiz Arbeiten ausführen wollen. ........
Artikel 162 des Vereinbarungsentwurfs vom 19. März 2018 über den Austritt des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien (UK) aus der Europäischen Union (EU) enthält das Muster für die Streiterledigung, das auch im Falle der Schweiz zur Anwendung kommen wird. ........
Die 27 EU-Mitgliedländer haben in ihrem Verhandlungs-Mandat vom 29. April 2017 zum Brexit gemeinsam folgende Grundsätze formuliert:
1. Jedes Abkommen EU/UK muss auf einem ausgewogenen Ausgleich von Rechten und Pflichten beruhen.
2. Der Schutz der Integrität des Binnenmarktes schliesst eine sektorielle Beteiligung am Binnenmarkt aus.
3. Ein Nicht-Mitglied ........
Nach Artikel 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) über die Auslegung des gemeinsamen Binnenmarktrechts.
Die letztinstanzlichen nationalen Gerichte sind verpflichtet, Fragen zur Auslegung des europäischen Binnenmarktrechts dem EuGH zur Entscheidung vorzulegen.
Der Auslegungsentscheid des EuGH ist für das nationale Gericht verbindlich. ........
Schweizer Europa-Gegner behaupten gerne die Machtlosigkeit der kleineren Staaten in der europäischen Gemeinschaft. ........
Die Schweizer Rechtsnationalen haben in der Bundesratswahl NR Cassis ihre Stimme gegeben, weil er ihnen versprochen hat, er werde in der Schweizer Europapolitik den Reset-Knopf drücken.
Rahmenabkommen und „fremde Richter“ lehne er ab. ........
Laut ihrem Präsidenten will Economiesuisse das bilaterale Verhältnis mit der EU weiterentwickeln. Ein Austritt aus dem europäischen Binnenmarkt, wie ihn die rechtsnationale SVP anstrebt, steht für Economiesuisse nicht zur Debatte.
Soweit es um die Anwendung des europäischen Binnenmarktrechts geht, ist der Europäische Gerichtshof (EuGH) als letzte Instanz zuständig.
Das anerkennt Economiesuisse auch für die Anwendung des europäischen Binnenmarktrechts in der Schweiz. ........
Rechtsnationale Parteien, welche die EU bekämpfen und auflösen wollen, werden regelmässig von Oligarchen finanziert.
Das ist in Grossbritannien so, aber auch in Italien, in Frankreich, in den Niederlanden, in Österreich etc. – auch im Nicht-Mitgliedsland Schweiz. Das Trumpsche Amerika marschiert in dieselbe Richtung.
Die EU basiert auf gemeinsamen Regeln, die in langwierigen Prozessen – unter Beteiligung von 28 Mitgliedsländer - erarbeitet werden.
Wer Macht in der Gesellschaft ausübt und wie das geschieht, ist damit voraussehbar. ........
Die Briten in der Schweiz sind heute EU-Bürger.
Nach dem Personenfreizügigkeitsabkommen (PFZA)haben sie das Recht, in die Schweiz zu ziehen und hier eine Erwerbstätigkeit auszuüben.
Mit dem Austritt von Grossbritannien aus der EU verlieren die Briten ab April 2019 dieses Recht. Sie werden dann neu zu Drittstaatsangehörigen ohne Rechtsanspruch auf Aufenthalt in der Schweiz.
Neu sind sie ausschliesslich dem Schweizer Ausländergesetz unterstellt. ........
Bereits ein Jahr nach Abschluss, am 4. November 2016 ist das Pariser Klimaschutzabkommen vom 12. Dezember 2015 in Kraft getreten.
55 Staaten, auf die mindestens 55 Prozent der globalen Treibhausgas Emissionen entfallen, haben bei der UNO das Abkommen ratifiziert.
Das war Voraussetzung für das Inkrafttreten. Die Schweiz hat das Abkommen am 2. April 2016 unterzeichnet, aber bis November 2016 noch nicht ratifiziert. ........
„Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig“.
„Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt.“ ........
Am 12. Mai 2004 versprach der Bundesrat der EU, ihr eine Milliarde Franken zugunsten der EU-Kohäsion zu bezahlen.
Die Milliarde wurde in fünf Tranchen à 200 Millionen aufgeteilt und der Bundeskasse 2007 – 2011 belastet. .......
Die EU hat vor eineinhalb Jahren dem Bundesrat mitgeteilt, sie wolle auf keine Verhandlungen über eine Änderungdes Personenfreizügigkeitsabkommen [PFZA] im Sinne des MEI-Artikels 121a BV eintreten.
Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Trotzdem kommuniziert der Bundesrat, es fänden Gespräche statt und man sei einer Lösung nahe.
Worüber wird denn gesprochen? Von der Abänderung des Personenfreizügigkeitsabkommens [PFZA] hat sich der Bundesrat ohne grosse Kommunikation selbst verabschiedet. ........
Kroatien ist am 1. Juli 2013 als 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union beigetreten.
Es hat grundsätzlich den gesamten Rechtsbestand der EU übernommen.
Formell erfolgte die Übernahme des EU-Rechts, einschliesslich der Staatsverträge, automatisch mit dem Inkrafttreten des Beitritts am 1.Juli 2013. ........
Im Februar 2016 hat der Bundesrat seine Aussenpolitische Strategie 2016-2019 veröffentlicht.Sein Kernziel ist es, "ein geregeltes, partnerschaftliches und ausbaufähiges Verhältnis zur EU sicherzustellen".
Dabei setzt er nach wie vor auf den Bilateralen Weg, ohne diesen allerdings – wie in der Vergangenheit – als „Königsweg“ zu bezeichnen.
Der Bilaterale Weg sei eine Form der Zusammenarbeit, der den Ausbau und die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ermögliche und in beiderseitigem Interesse sei. ........
Der Vertrag über die Personenfreizügigkeit ist innert drei Jahren neu zu verhandeln und anzupassen.
Das verlangt die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) der Rechtsnationalen.
Das Volk hat dem am 9. Februar 2014 knapp zugestimmt. ..........
Strache in Österreich, Le Pen in Frankreich, Wilders in Holland, Farage in England,Blocher in der Schweiz, Vona in Ungarn, Soini in Finnland, Michaloliakos in Griechenland. ........
Im Vorfeld der Wahlen 2015 lautet die Devise des Bundesrates und der Mitte-Rechts-Parteien: Bilateralismus Ja, EU-Beitritt Nein.
Über Inhalt und Konsequenzen des Bilateralismus findet keine rationale Debatte statt.
Der Bilateralismus wird von der Politik nach wie vor als schweizerischer Königsweg propagiert.
Das schweizerische Konzept des Bilateralismus beinhaltet eine laufende Übernahme von EU- Binnenmarktrecht, ohne an der Rechtsetzung des EU-Binnenmarktrechts beteiligt zu sein. ........
Soll sich die Schweiz weiterhin am europäischen Binnenmarkt beteiligen, ja oder nein?
Das ist die aussen- und wirtschaftspolitische Kernfrage der nächsten Legislatur.
Nicht die von den Rechtsnationalen bevorzugte Frage der MEI-Umsetzung.
EU-Mitgliedschaft, EWR-Mitgliedschaft oder Bilaterale Verträge: immer geht es um das Gleiche, um die Beteiligung am europäischen Binnenmarkt.
Unterschiede bestehen lediglich in Ausmass und Form der Beteiligung. ........
Mit den bilateralen Verträgen hat sich die Schweiz ab 1. Juni 2002 am EU-Binnenmarkt beteiligt.
Seither übernimmt sie laufend EU-Binnenmarktrecht.
Zum Inhalt des übernommenen EU-Binnenmarktrechts hat die Schweiz nichts zu sagen.
Es wird auf Antrag der EU-Kommission gemeinsam vom EU-Parlament und vom Europäischen Rat erlassen.
Im Europäischen Rat sind alle Regierungen der 28 EU-Mitgliedsländer vertreten, nicht aber die Schweiz.
Mit den Bilateralen hat die Schweiz freiwillig "souverän" auf eine Vertretung in der EU-Kommission, im EU-Parlament und im Europäischen Rat verzichtet.
Sie ist damit zufrieden, wenn ihr jedes Jahr im Gemischten Ausschuss von einem Beamten der EU-Verwaltung mitgeteilt wird, welches EU-Binnenmarktrecht sie übernehmen muss. .........
Der abrupte Ausstieg der Nationalbank aus der Franken-Euro-Bindung löst bei vielen Patrioten Hochgefühle aus.Die Medien sind voll von überschwänglichen Kommentaren.
Endlich sind wir wieder frei und souverän. Die Kosten nehmen wir gerne in Kauf.
Zumal wir jetzt mit dem starken Franken im Euroland extrem günstig einkaufen und Ferien machen können.
In Siegesstimmung - wenn auch nicht patriotischer Art - sind sodann die vielen russischen, arabischen, griechischen, chinesischen, afrikanischen etc. Oligarchen mit CHF-Konten bei Schweizer Banken.
Die Nationalbank hat sie über Nacht um 20% reicher gemacht. ........
Der Rat der Europäischen Union für Allgemeine Angelegenheiten hat am 16. Dezember 2014 Schlussfolgerungen zu den Beziehungen der EU zur Schweiz beschlossen und diese publiziert.
Die Schweiz hat davon kaum Kenntnis genommen.
Der Bundesrat hat die Stellungnahme nicht kommentiert. ........
Es gibt wohl kaum eine Publikation in der Schweiz, die Politik und Wirtschaft mehr Ratschläge erteilt, wie man es besser machen sollte, als die Neue Zürcher Zeitung.
Derart geballtes Knowhow sollte eigentlich in der Lage sein, die aktuellen Umbrüche in der Medienwelt zu bewältigen und das Unternehmen NZZ, Print und Online, wieder in ruhiges Fahrwasser zu lenken.
Offenbar ist aber das Erteilen guter Ratschlägen einfacher als das Umsetzen. .........
Die Preise fürr gleichwertige Güter sind in der Schweiz durchschnittlich 10-20% höher als in den Nachbarländern. Die Löhne für gleichwertige Arbeitsleistungen sind durchschnittlich 20 bis 30% höher.
Hauptursache ist die massive Aufwertung des Schweizer Frankens ab 2008 bis 2011.
Der Vergleich des kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-BIP der Schweiz mit dem kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-BIP der Nachbarländer zeigt, dass das Ausmass der Aufwertung keine realwirtschaftliche Grundlage hat.
Die Folge sind grosse Verzerrungen in den grenzüberschreitenden Arbeits- und Gütermärkten.
Die Preissignale laufen offensichtlich falsch. ........
Putinversteher haben grosses Verständnis für die russische Annexion der Krim und die russische Militärintervention in der Ukraine.Endlich sehen sie jemanden mit dem Mut, in Europa bestehende Grenzen zu überschreiten, um die natürliche Hierarchie der Völker auf diesem Kontinent wieder herzustellen. ........
Wer was verkaufen will, muss Emotionen in Gang setzen.
Apple ist in diesem Fach wohl Weltmeister.
Nach einem perfekt umgesetzten Emotionsschub in den social media standen Massenstundenlang vor den Läden Schlange, um das neue iPhone6 zu bekommen.
In nur drei Tagen waren 10 Millionen Geräte verkauft.
In der Politik spielt derselbe Mechanismus.
Gerade in der schweizerischen Volksdemokratie. ........
Der Bundesrat unternimmt grösste Anstrengungen, damit die Schweiz in supranationalen Gremien mit Sitz und Stimme vertreten ist. ........
Auf politischen Druck der Rechtsnationalen hat sich die Schweiz nach dem Nein zum EWR im Dezember 1992 für den sogenannten Bilateralen Weg entschieden.
Im Wissen um die Mängel der Bilateralen sah der Bundesrat darin ursprünglich eine Übergangslösung.
Wegen der sinkenden Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft hat er ab dem Jahr 2000 die Sichtweise geändert und die Bilateralen zum Königsweg erklärt.
Heute gelten die Bilateralen innenpolitisch als Dauerlösung. Mit einem institutionellen Rahmenabkommen sollen sie definitiv als Schweizer "Königsweg" verankert werden. ........
Neuerdings ist auch die NZZ der Meinung, in der Volksdemokratie schweizerischer Prägung stehe es der Mehrheit frei, individuelle Grundrechte mittels Volksinitiativen auszuschalten.
Die kollektive Macht der Mehrheit über den Einzelnen oder über Minderheiten darf danach durchaus schrankenlos, willkürlich und absolut sein. ........
Während in der Europäischen Union 400 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger ihr Parlament wählen, nimmt das Feindbild EU in der Schweiz immer groteskere Züge an.
Ein schweizerisches Massenblatt aus Zürich freut sich allen Ernstes, dass die Schweiz in den rechtsnationalen Parteien der EU endlich neue Freunde gefunden habe. ........
Eine gewagte These. Weshalb sollte die Währungspolitik der Nationalbank das herrschende fremdenfeindliche Klima fördern?
Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass der Schweizer Franken seit drei Jahren gegenüber dem Euro (und dem Dollar) konstant um 10 bis 15% überbewertet ist.
Am 6. September 2011 setzte die Nationalbank den Euro-Kurs mit 1.20 Franken pro Euro fest.
Die damalige Massnahme, d.h. die Bindung des Schweizer Frankens an den Euro, war unerlässlich, um Schaden von der Schweizer Volkswirtschaft fern zu halten. .........
Die US-Behörden haben in den letzten Jahren Milliardenbussen gegen Schweizer Grossbanken ausgefällt: ........
Die Armee hat die Aufgabe für unser Land Sicherheit zu schaffen und zwar primär nach aussen.
Sie ist keine Polizei- oder Hilfspolizeiorganisation für Einsätze im Inland.
Dafür haben wir mit gutem Grund nach föderalistischem Prinzip organisierte kantonale Polizeikorps. ........
Die Schweiz ist seit 2002 auf eigenen Wunsch am EU-Binnenmarkt beteiligt. Wohlstand und wirtschaftliche Zukunft der Schweiz hängen von dieser Beteiligung ab.
Was der Binnen- markt ist, wie er funktioniert, ist indessen kaum ein Thema, weder im Bundehaus, noch in den Medien.
Die 28 Mitgliedstaaten der EU (ohne die Schweiz) haben sich im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einstimmig auf fünf Grundfreiheiten im Binnenmarkt verständigt: ........
Staatliche Ausgaben können über Steuern, Schuldenmachen oder Gelddrucken finanziert werden.
Historisch betrachtet war und ist das Gelddrucken die beliebteste Geldbeschaffungsmethode der Regierungen.
Dann folgen das Schuldenmachen und schliesslich die Erhebung von Steuern. ........
Das Bundesgesetz vom 21. Dezember 2007 über die neue Spitalfinanzierung (Artikel 39, 41, 49 und 49a KVG) ist seit 1. Januar 2009 in Kraft.Einführungszeitpunkt war gemäss den Über-gangsbestimmungen der 1. Januar 2012.
Die Gesundheitskommission des Ständerates hat in den Jahren 2004‐2006 die wesentlichen Eckwerte entwickelt. .......
Wer kontrolliert wen? Der Bürger den Staat oder der Staat den Bürger? Im demokratischen Rechtsstaat sollte das Erstere der Fall sein.
Die Realität ist eine andere: der Staat kontrolliert den Bürger. ........
Dass der US-Fiskus bei US-Staatsbürgern, ungeachtet wo sie wohnen, weltweit US-Steuern einziehen will, ist ein Faktum.
Er möchte daher auch wissen, wo weltweit US-Bürger und andere US-Persons welches Geld auf welchen Bankkonten haben. ........
Die Probleme der Schweiz mit dem Gemeinschaftsrecht und dem EuGH rühren jedenfalls zum Teil daher, dass die Schweiz laufend und in immer grösserem Umfang Gemeinschaftsrecht übernimmt, eine Beteiligung an der gemeinschaftlichen Rechtsetzung und Rechtsprechung aber ablehnt, auch für den Bereich des Arbeitsmarktes.
Das Gemeinschaftsrecht, eingeschlossen die Urteile des EuGH, ist nur beschränkt bekannt. Dementsprechend bleibt die Debatte in Polemik stecken. ........
Mit Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 hat der Bund die Pflegefinanzierung neu geordnet.Das Gesetz trat am 1. Januar 2011 in Kraft.
Kern bildet der neue Artikel 25a KVG über die Pflegeleistungen bei Krankheit.
Danach wird die Pflege in Pflegeheimen aus drei Quellen finanziert: ........
Das alltägliche Verhältnis der Schweizerinnen und Schweizer zu ihren europäischen Nachbarn ist unkompliziert.
Man reist beidseitig über die Grenze. Viele private und geschäftliche Beziehungen bestehen seit Jahren und haben sich intensiviert.
Natürlich wird auch grenzüberschreitend eingekauft. Die Schweiz deckt 78% ihres Imports aus der Union deckt und verkauft 60% ihres Exports dorthin.
Selbstverständlich werden grenzüberschreitende Dienstleistungen in Anspruch genommen.
Viele verbringen Freizeit und Ferien im angrenzenden Nachbarland. ..........
Das Gemeinwesen hat als Arbeitgeber nach BVG und OR, wie andere Arbeitgeber in der beruflichen Vorsorge, insbesondere folgende Pflichten mit finanziellen Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Gemeinwesens.
Bilateralismus bedeutet Übernahme des europäischen Rechts unter gleichzeitigem Verzicht auf eine Mitgestaltung des übernommenen Rechts.
Mit den bilateralen Verträgen hat die Schweiz die Regeln über die Personenfreizügigkeit in der EU übernommen.
Nach diesen Regeln haben